Der Klassenkampf in der Provinz
Ingrid Thoms-Hoffmann erinnert sich an die Schüler-Revolte am Wertheimer Gymnasium
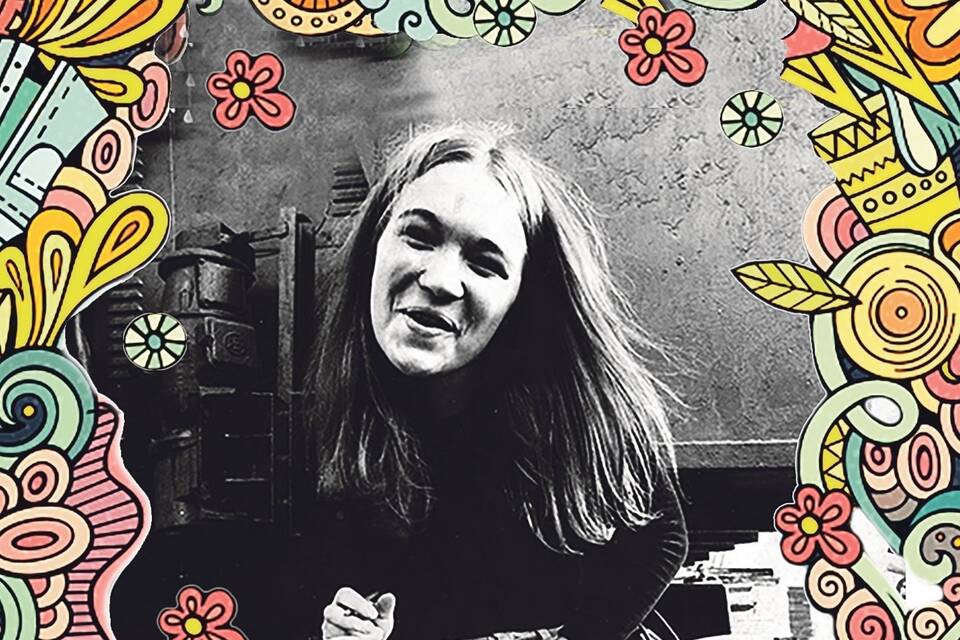
Von Ingrid Thoms-Hoffmann
Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: "Die Schülerbewegung lehnt die Schule als Anpassungsinstrument an ein formal pluralistisches, inhumanes Gesellschaftssystem ab und fordert die Auflösung von nicht legitimierter Herrschaft." Ja, so waren wir: einfach großartig. Unglaublich, dass wir das geschrieben haben, mit 17, 18 oder 19 Jahren. Und wir
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+



