Wie Bürgermeister Neinhaus eine Mitarbeiterin wegen jüdischer Freunde loswerden wollte
Ein Gericht hob die Entlassung auf, Wiesert durfte weiter arbeiten. Der Fall zeigt: Zu diesem Zeitpunkt gab es in der Diktatur noch Spielräume für Menschen mit Gewissen und Rückgrat. Carl Neinhaus aber fehlte es an beidem.

Von Sebastian Riemer
Heidelberg hat seinem ehemaligen Oberbürgermeister Carl Neinhaus den Ehrengrabstatus aberkannt. Der Entscheidung des Gemeinderats im Februar vorausgegangen war ein Gutachten des Historikers Frank Engehausen. Dieser schrieb: Neinhaus sei zwar "kein fanatischer Nationalsozialist", aber ein "politischer Opportunist" gewesen. Er habe "am administrativen Vollzug von NS-Unrecht mitgewirkt" und eine "rasche und rückhaltlose Anpassung an das nationalsozialistische Regime" vorgenommen.
Wie rasch und rückhaltlos Neinhaus die nationalsozialistische Ideologie schon sehr früh auf eigene Initiative – ohne unter Druck gesetzt zu werden – durchsetzte, zeigt der Fall Therese Wiesert (1893 - 1990). Der RNZ liegen die Akten der Stadt und der Gerichte dazu in Kopie vor.
Erste Fürsorgerin in Heidelberg
Therese Wiesert ist 22 Jahre jung, als sie 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, als Fürsorgeschwester bei der Stadt anfängt. Sie geht zu den Familien in die einfachen Quartiere der Altstadt, berät Mütter, pflegt Neugeborene. Von Hygiene und Medizin wissen die meisten damals nicht viel. Die Säuglingssterblichkeit ist hoch, gerade in den ärmeren Schichten. Wiesert sorgt dafür, dass mehr Kleinkinder überleben. Die junge Frau macht ihre Sache gut: 1921 wird sie als erste Fürsorgerin verbeamtet, darf sich von nun an "Oberfürsorgerin" nennen.
Auch interessant
Zwölf Jahre später, im Januar 1933, kommt Adolf Hitler an die Macht und beginnt, den Staat nach seinem nationalsozialistischen, menschenverachtenden Programm umzubauen. Für Therese Wieserts Arbeit ändert das zunächst wenig, ihr oberster Dienstherr bleibt derselbe: Oberbürgermeister Carl Neinhaus, der am 1. Mai 1933 der NSDAP beitritt.
Therese Wiesert ist seit Jahren befreundet mit Hermann Maas, geht in dessen Pfarrhaus als "Tante Resi" ein und aus. Der evangelische Pfarrer von Heiliggeist bezeugt öffentlich seine Solidarität mit den verfolgten Juden. Unzähligen hilft er, etwa bei der Emigration in sichere Länder. Wiesert und Maas arbeiten in der "Bekenntnisgemeinschaft" zusammen, die sich abgrenzt gegen die "Deutschen Christen", die Christen jüdischer Herkunft ausschließen und die Evangelische Kirche gleichschalten wollen.
Freundschaft mit zwei Familien
Wiesert ist gut befreundet mit der Familie von Albert Fraenkel. Der hoch angesehene Arzt entstammt einer jüdischen Familie, konvertiert 1896 zum Christentum. In Heidelberg gründet der Herz- und Tuberkuloseforscher die Krankenhäuser Rohrbach (heute Thoraxklinik) und Speyererhof (heute Kliniken Schmieder). Unmittelbar nach der Machtübernahme entheben ihn die Nationalsozialisten aller Ämter, weil Fraenkel nach ihrer Auffassung "Volljude" ist. Wenige Wochen nach der Pogromnacht im November 1938 stirbt er. Die Trauerrede auf dem Bergfriedhof hält Hermann Maas.
Therese Wiesert kommt schon 1917 über Tochter Annemarie mit den Fraenkels in Kontakt. Und als Annemarie im Jahr 1933 Heidelberg verlässt, ist Wiesert längst eine Freundin auch der Eltern Erna und Albert geworden. Sie besucht mit Erna – im Duktus der Nazis eine "Vollarierin" – Konzerte und den Gottesdienst. "Ich, die ich hier keine Angehörigen habe, fand in deren Hause liebevolle Aufnahme", schreibt Wiesert später in dem Beschwerdebrief, mit dem sie gegen ihre Entlassung vorgeht.
Ebenso warmherzig schreibt Wiesert im selben Brief über ihre Bekanntschaft zu einer anderen Familie: "Professor Heinsheimer, der mich von den gemeinsamen Fahrten in der Straßenbahn her kannte, bot mir eines Tages an, einen Windelvorrat für Säuglinge aus bedürftigen Familien zu stiften." Der Jurist Karl Heinsheimer, von 1927 bis zu seinem Tod 1929 Rektor der Heidelberger Universität, spendet jahrelang Windeln für Wieserts Klienten. Seine einzige Bedingung: Sie muss die "Windelquelle" geheim halten. Er ist 1899 vom Juden- zum evangelischen Christentum konvertiert, und anders als Fraenkels Frau Erna ist auch Heinsheimers Frau Anna eine getaufte Jüdin. Nach Karl Heinsheimers Tod wird Wieserts Verhältnis zur Familie enger: Sie besucht regelmäßig Anna und deren alte Mutter, "die nicht mehr ausgehen kann und der ich mit meinen Besuchen eine besondere Freude mache", so Wiesert in ihrem Beschwerdebrief.
Therese Wiesert wird denunziert
August 1935: Therese Wiesert wird bei der Stadt denunziert, "engen Verkehr mit den jüdischen Familien Fraenkel und Heinsheimer" zu unterhalten. Sie ist sicher: Irma Weber steckt dahinter, eine Mitarbeiterin der Deutschen Arbeitsfront, die sich offenbar Hoffnungen auf Wieserts Stelle in der städtischen Fürsorgearbeit macht.
OB Carl Neinhaus eröffnet ein Dienststrafverfahren gegen seine Oberfürsorgerin, sie wird zur Vernehmung vorgeladen. "Ein solcher Verkehr" könne im nationalsozialistischen Staat nicht geduldet werden, erklärt man ihr. Therese Wiesert erbittet Bedenkzeit – und erklärt nach vier Tagen, dass sie "nach reiflicher Überlegung den Verkehr, der schon über zehn Jahre bestehe, nicht abbrechen könne". Eine andere Einstellung könne sie nach ihrem christlichen Gewissen nicht einnehmen. In der Sitzung des städtischen Disziplinarausschusses wenig später bleibt sie dabei: Sie könne den Kontakt zu den Familien nicht beenden.
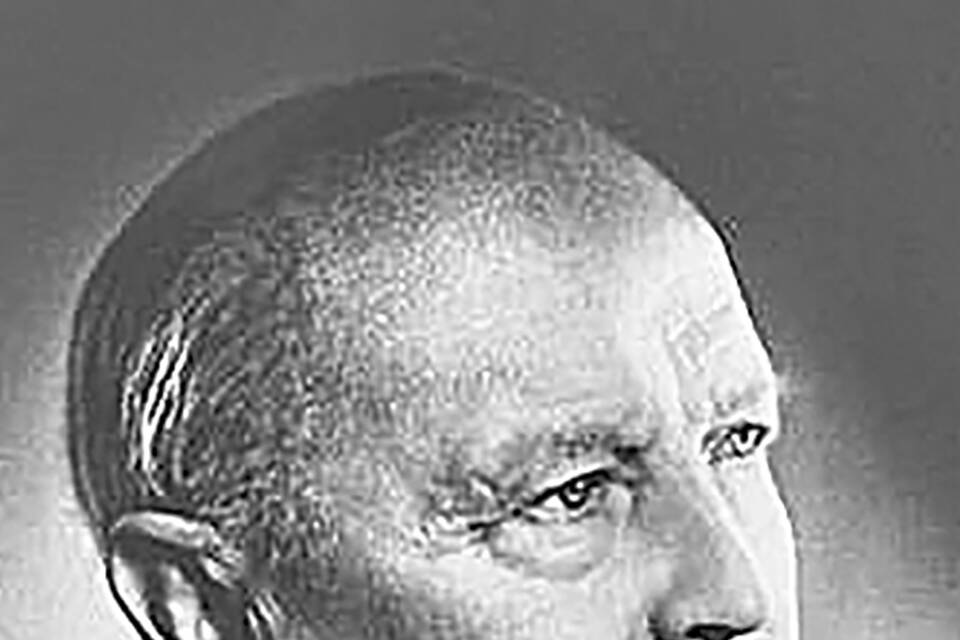
Entlassung nach 20 Jahren Dienst
Jetzt macht Neinhaus ernst: Er entlässt Therese Wiesert – nach fast 20 Jahren im Dienst der Stadt. Auch ihre Pension entzieht er ihr. Lediglich ein Übergangsgeld von 60 Reichsmark im Monat soll sie bekommen – höchstens so lange, bis sie eine andere Stelle gefunden hat. Neinhaus’ Entlassungsschreiben, gezeichnet von ihm selbst sowie von Personalamtschef Wilhelm Schneider, trägt das Datum des 24. September 1935 – neun Tage zuvor hat Hitler die Nürnberger Gesetze erlassen.
Weil es für die Entlassung dennoch keine Rechtsgrundlage gibt, konstruiert Neinhaus eine fadenscheinige, politische Begründung: Wiesert setze sich mit ihrem Kontakt zu den Familien Fraenkel und Heinsheimer "in Widerspruch zu den wichtigsten Grundsätzen der nationalsozialistischen Staatsführung" und verletze die "ihr obliegende Treuepflicht gegen den Führer und die Volksgemeinschaft". Ein Satz sticht aus dem Schreiben heraus: "Wer in einer so grundlegenden Frage, wie sie die Einstellung des deutschen Volkes zu den Juden darstellt, nicht die Weisungen des Führers und Reichskanzlers befolgt, beweist damit, dass er die von jedem deutschen Volksgenossen, vornehmlich aber von einem deutschen Beamten zu fordernde Treue nicht hält." Daran könnten auch "bisherige gute Arbeitsleistungen nichts ändern".
Wiesert wehrt sich
Therese Wiesert legt sofort Beschwerde ein, erst sie selbst, dann auch ihr Anwalt Edwin Leonhard. Sie weicht keinen Schritt zurück und schreibt: "Es erscheint mir notwendig, hier noch einmal ausdrücklich zu betonen, dass meine Einstellung aus tiefster innerer Überzeugung kommt und dass ich mich als evangelischer Christ gebunden fühle an das, was Schrift und Bekenntnis von den Gliedern der Kirche fordern." Es sei ihr unverständlich, wie sie durch den Verkehr mit den beiden Familien ihre Beamtenpflichten verletzt haben soll. Als Replik auf Neinhaus’ Behauptung, sie habe damit unter den städtischen Angestellten "vielfach Anstoß" erregt, schreibt Wiesert einen bemerkenswerten Satz – dezent in Klammern gesetzt: "Dass mir in meiner ganzen Amtszeit noch niemals so viel Achtung von Kollegen und Kolleginnen entgegengebracht worden ist, wie in diesen letzten Wochen, muss ich um dieser Kollegen und Kolleginnen willen wohl verschweigen!"
Bemerkenswert auch Wieserts Anwalt Edwin Leonhard, der in seinem furiosen Beschwerdebrief an die nächsthöhere Instanz, den Landeskommissär in Mannheim, den Wert des persönlichen Gewissens weit über den der "ideologischen Treue" stellt. Es ist ein offener Angriff auf die nationalsozialistische Ideologie – und zeigt deutlich, welchen Spielraum andere Menschen als Carl Neinhaus 1935 noch nutzen. Man könne durchaus "die Gefahren des Judentums so hoch einschätzen wie der leidenschaftlichste Anhänger der Bewegung, (...) und man kann dennoch der Meinung sein, dass im privaten Leben es dem Einzelnen überlassen bleiben muss, seinem Gewissen gemäß zu entscheiden, ob er (...) den Verkehr mit einer nichtarischen Person abbrechen will oder nicht". Und seine Mandantin könne es eben einfach nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, "zwei Familien fallen zu lassen, von denen sie während ihres ganzen Lebens nur liebevolle Teilnahme und Fürsorge erfahren hat". Noch deutlicher wird Leonhard, wenn er schreibt, er wage die Behauptung, dass Therese Wiesert unter der Heidelberger Beamtenschaft "allgemein höchste Achtung" entgegengebracht werde, gerade "weil sie um einer inneren Überzeugung willen, ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet". Schließlich kennzeichne ein solches Verhalten "unwiderlegbar" (!) einen wertvollen Menschen, der alles andere verdiene, als dass man ihn "als schädliches Mitglied der Volksgemeinschaft" bezeichne und ausstoße.
Neinhaus verschärft den Ton
Nach Wieserts Beschwerde liegt die Rechtssache nun bei Landeskommissär Scheffelmeier in Mannheim. Neinhaus greift erneut aktiv ein – und untermauert am 7. November in einem Schreiben an Scheffelmaier seine Position. Wiesert sei in Schulungen deutlich auf den "verderblichen Einfluss der jüdischen Rasse" hingewiesen worden und wolle trotzdem weiter "freundschaftlichen Verkehr mit Angehörigen dieser Rasse unterhalten". Daher sei ihr Verbleib im Dienste des nationalsozialistischen Staates unmöglich.
In einem besonders abstoßenden Satz geht Neinhaus auf die Tatsache ein, dass Albert Fraenkels Frau nach der Definition der Nationalsozialistin Arierin ist: "Die Einstellung des Verkehrs mit jüdischen Familien muss auch dann verlangt werden, wenn (...) nur ein Ehegatte Volljude ist, denn durch das innige Zusammenleben mit dem jüdischen Gatten ist nach nationalsozialistischer Auffassung auch der nichtjüdische Ehepartner in völkischer Beziehung verdorben und für das deutsche Volk verloren."
Anwalt Leonhard wirft Neinhaus daraufhin eine "Überspannung" des Prinzips der Reduzierung des Kontakts mit Juden vor, "eine Überspannung, die von der Regierung nicht gebilligt wird" – schließlich seien ja auch eine Reihe arischer Richter, Lehrer und Professoren noch im Amt, die mit jüdischen Ehefrauen verheiratet sind.
Doch der Landeskommissär ist ganz auf Neinhaus’ Linie: Mit ausführlicher rassenideologischer Begründung bestätigt er die Entlassung und lehnt Wieserts Beschwerde drei Tage vor Weihnachten 1935 ab.
Karlsruhe gibt Wiesert Recht
Therese Wiesert klagt weiter beim Verwaltungsgerichtshof in Karlsruhe. Während sie auf die Verhandlung wartet, reist sie im März 1936 nach London, um dort in einer kirchlichen Institution der Wohlfahrtspflege zu arbeiten. Die Fürsorgerin ist überzeugt, "die mir auferlegte Wartezeit nicht besser nützen zu können, als mit einem Aufenthalt dort meine beruflichen Kenntnisse zu erweitern".
Am 12. Mai 1936 bekommt Therese Wiesert fast auf ganzer Linie recht. Der Verwaltungsgerichtshof hebt die Entlassung durch Neinhaus auf, sie darf wieder bei der Stadt arbeiten. Die Verhandlung in Karlsruhe zeigt: Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine rechtsverbindliche Regel, inwieweit Beamte Kontakt zu Juden haben dürfen. Neinhaus preschte in vorauseilendem Gehorsam vor, war im Fall Wiesert schon weiter als die glühenden Antisemiten in Berlin. Das Gericht konstatiert zwar ein Dienstvergehen Wieserts, da für Beamte eine allgemeine "Pflicht zur weitgehenden Zurückhaltung" im Umgang mit Juden gelte, doch rechtfertige dies keinesfalls ihre Entlassung, höchstens eine Versetzung in "ein anderes Amt derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn", bei gleichbleibendem Dienstrang und Lohn.
Ab Juli 1936 arbeitet Therese Wiesert wieder bei der Stadt – als Sachbearbeiterin im Wohlfahrtsamt. Entgegen der Gerichtsentscheidung wird ihr Gehalt leicht herabgestuft.
Von Gnade, Ehre und Rehabilitation
Im April 1948 hebt das Land das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs gegen Wiesert von 1936 auf – im Wege der Gnade. Sie lehnt die Begnadigung per Brief ab, da das damalige Urteil "doch nur durch die nationsozialistische Rechtsauffassung" möglich gewesen sei und "mit dem Verschwinden derselben ohne Weiteres seine Rechtskraft verlieren" müsse. 1959 geht Wiesert als Oberfürsorgeinspektorin in den Ruhestand. Bei ihrer Entlassung hebt Bürgermeister Rausch hervor, "wie sehr Wiesert es verstanden habe, auch die schwierigsten Situationen mit einem Vers von Wilhelm Busch humorvoll zu meistern" (RNZ vom 2. Juli 1959).
Carl Neinhaus wird im Entnazifizierungsverfahren zunächst als "Mitläufer", später als "Entlasteter" eingestuft. 1952 wird er Präsident der Verfassungsgebenden Versammlung, dann des Landtags – und im selben Jahr wieder Oberbürgermeister Heidelbergs.
Carl Neinhaus stirbt 1965, bekommt ein Ehrengrab auf dem Bergfriedhof. Wiesert stirbt 1990 im Alter von 96 Jahren – auch sie wird auf dem Bergfriedhof beigesetzt. Im November 2020 entscheidet der Gemeinderat, eine Straße im Rohrbacher Hospital-Quartier nach ihr zu benennen. Knapp anderthalb Jahre später erkennt das Gremium den Ehrengrabstatus für Carl Neinhaus ab.



