Die Geheimnisse hinter den Kunstwerken der Sammlung Prinzhorn
Hier werden Werke von Psychiatrie-Insassen gezeigt. Warum wurden sie kreativ?

Von Julia Lauer
Heidelberg. Als Thomas Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn, vorsichtig einen bestickten Teppich vor den RNZ-Lesern ausbreitet, greift das Erstaunen um sich. "Ach", "nein", "irre", entfährt es den Sommertouristen beim Anblick des außergewöhnlichen Stücks in dem Museum in der Psychiatrie in Bergheim. Bei dem Wort "irre" horcht Röske auf. Ist es irre, was die Patientenkünstlerin Emma Mohr mit diesem Teppich in den 1870er-Jahren schuf?

Die Sammlung Prinzhorn zeigt Kunst von "Menschen mit psychischen Ausnahme-Erfahrungen", wie es Röske formuliert. Viele Sammlungsstücke entstanden in Heilanstalten – so auch dieses. Emma Mohr, die Patientin, habe an Trugwahrnehmungen gelitten. Zugleich folgte sie mit ihrem Werk durchaus einer Logik.
"Sie wusste, es gibt Zensur", berichtet der Sammlungsleiter. Die Patientin versuchte, die Zensur mit ihren Stickereien zu unterlaufen und ihren Hilferuf so in die Welt zu bringen. Der Teppich zeigt mehr als 50 bestickte Bilder, darauf zu erkennen sind Kaiser Wilhelm oder Szenen des Alten Testaments. Die Rückseite ist mit Briefen bestickt, Mohr verstand es, den Text in ihrer Handschrift zu sticken: Darin beschwert sie sich über ihre Internierung in der Klinik im heutigen Sachsen-Anhalt, Adressat ist der Kaiser.
Mohr habe gehofft, die Anstalt auf diesem Weg verlassen zu können, berichtet Röske den gebannt zuhörenden Sommertouristen. "Unglaublich, diese Schrift, diese Linien, und wie sie die Gesichtszüge eingefangen hat", wird später RNZ-Leserin Birgit Hermann aus Heidelberg sagen.
Auch interessant
"Weiß man etwas über sie?", will eine andere Leserin wissen. Doch viele Fragen zu dem Teppich, den das Museum erst seit Kurzem sein eigen nennt, der jedoch zu den kostbarsten Ausstellungsstücken der Sammlung zählt und der im kommenden Jahr dann auch öffentlich ausgestellt werden soll, sind noch offen.
War Mohr als Stickerin bekannt? Was will sie mit dem Teppich erzählen? Was genau zeigen die einzelnen Szenen? Das Werk sei sehr komplex, meint Röske. "Wir wissen, wer sie war, wer ihre Eltern waren und wo sie wohnte. Aber wir sind noch dabei, ihre Geschichte zu rekonstruieren."
Dass das Verständnis der Werke mitunter detektivische Kleinstarbeit erfordert, ist eines der Dinge, die auf dieser Sommertour deutlich werden. Denn Röske und sein Team sammeln die Stücke nicht nur, sie verfolgen auch beispielsweise nach, woher die Werke stammen und wer die Künstler sind.
"Wir versuchen zu verstehen, warum sie in der Gesellschaft angeeckt ist und weshalb sie in Verwahranstalten untergebracht wurden, damals oft 30, 40, 50 Jahre lang, bis zu ihrem Tode", erklärt er sein Interesse. Um den Antworten einen Schritt näherzukommen, muss er die entscheidenden Puzzleteile finden.
Das zeigt die Jacke der Anstaltspatientin Agnes Richter, die sie mit buntem Garn mit Sätzen bestickte. Bei der Jacke handelt es sich um eines der bekanntesten Stücke der Sammlung, doch sie ist gegenwärtig nicht im Museum zu sehen. Thomas Röske zeigt sie im Depot, das an die Ausstellungsflächen angrenzt und in dessen schweren Schränken diejenigen Werke in Kassetten lagern, die vor 1945 entstanden sind.
Wie auch die Restaurationsräume ist das Depot normalerweise nicht öffentlich zugänglich, doch Röske macht eine Ausnahme für die Sommertouristen, sodass sie einen Blick hinter die Kulissen werfen können.
"Ich bin in Hubertusburg", ist beispielsweise ein Satz, der in die Jacke gestickt ist. Ein anderer lautet: "Ich bin nicht groß." Agnes Richter war Näherin, die in den 1890er-Jahren alleine in Dresden lebte. Sie fühlte sich von ihrer Nachbarschaft bedroht, aufgrund von Wahnvorstellungen wurde sie in die psychiatrische Anstalt eingewiesen, die sie Zeit ihres Lebens nicht mehr verließ.
Immer wieder habe man die Bestände durchforstet, um dem Geheimnis der Jacke auf die Schliche zu kommen – schließlich fanden sich Dokumente, die aber kurioserweise auf zwei Patientinnen dieses Namens schließen ließen. Erst über die Wäschenummer 583, die Richter in ihre Jacke gestickt hatte und die auch in einer der beiden Akten auftauchte, gelang die Zuordnung: "Sie wollte sichergehen, dass ihre Jacke wiederkommt", kommentiert Röske die gestickte Nummer.
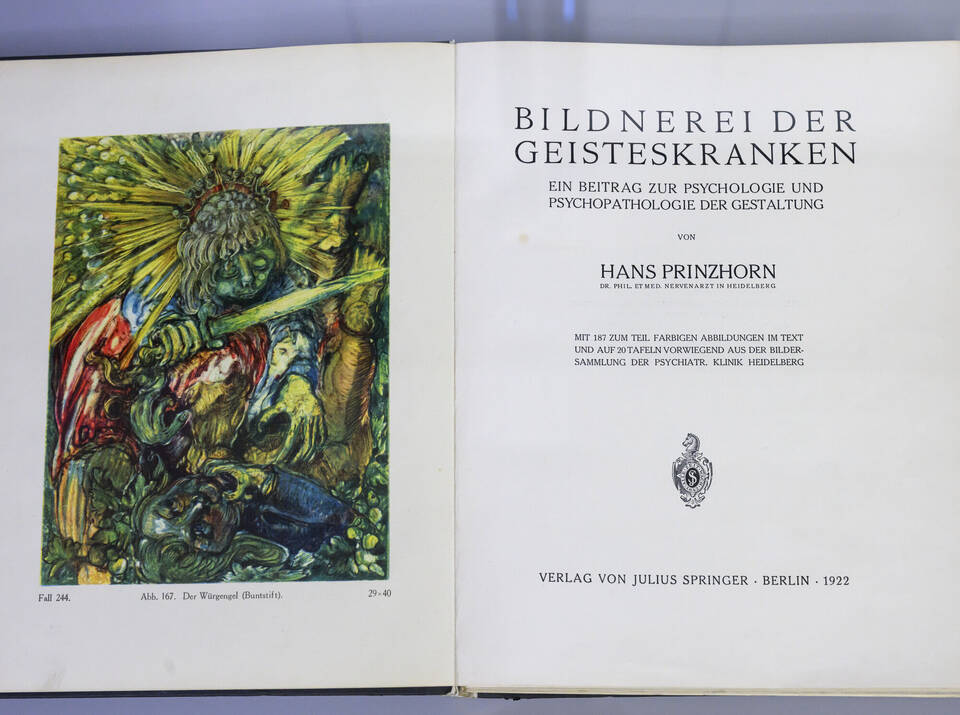
Doch warum stickte die Patientin die autobiografischen Textfragmente in ihre Anstaltskleidung? War es ein Aufbegehren gegen die Anonymität in der Klinik? Wollte sie Erinnerungen festhalten, die zu ihr gehörten? "Sie nutzte ihre Fähigkeiten möglicherweise als Stabilisierungshilfe", vermutet Röske. Mit der bestickten Jacke sei ihr zugleich ein Bruch in der Ästhetik ihrer Zeit gelungen.
Dabei, sagt er, sei es den meisten Anstaltspatienten nicht darum gegangen, Kunst zu schaffen. "Viele Bilder sind nicht mit der Absicht entstanden, dass sie im Kunstmuseum hängen", glaubt Röske. Oft seien die Menschen bewegt gewesen von ihren Erlebnissen und wollten sie darstellen, meint er. Würde das Museum an diesem Abend nicht bald schließen, würden ihm die Sommertouristen wohl noch länger zuhören. "Wir kommen wieder", versprechen manche zum Abschied.




