Wie die BASF für mehr Nachhaltigkeit sorgen will
Der Chemieindustrie wird eine wichtige Rolle zugesprochen. Der Chemiekonzen verfolgt verschiedene Ansätze.
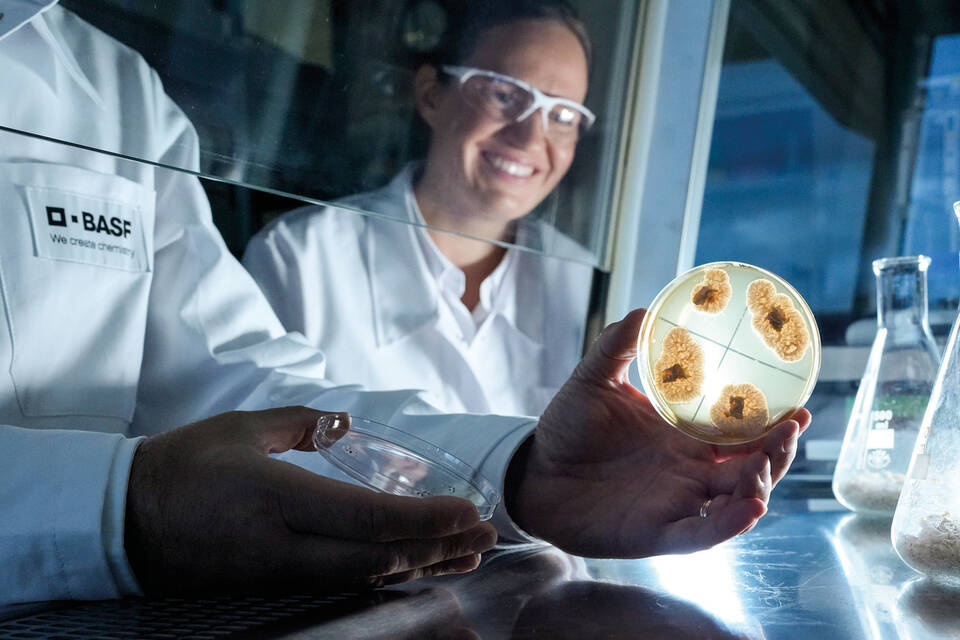
Von Barbara Klauß
Ludwigshafen. Die Welt muss nachhaltiger werden. Und dabei, meint Melanie Maas-Brunner, Mitglied des Vorstands und Chief Technology Officer der BASF, führe an der Chemieindustrie kein Weg vorbei. "Wir werden die Transformation hin zur Klimaneutralität nur mit innovativen Lösungen aus der Chemie schaffen", sagte sie kürzlich bei der Forschungspressekonferenz der BASF.




