Der große Schatz der Gemeinsamkeiten
"Von welcher Kultur lassen wir uns leiten?" - In Deutschland hat sie viele Wurzeln - Die "Leitkultur" wird nicht vom Staat verordnet
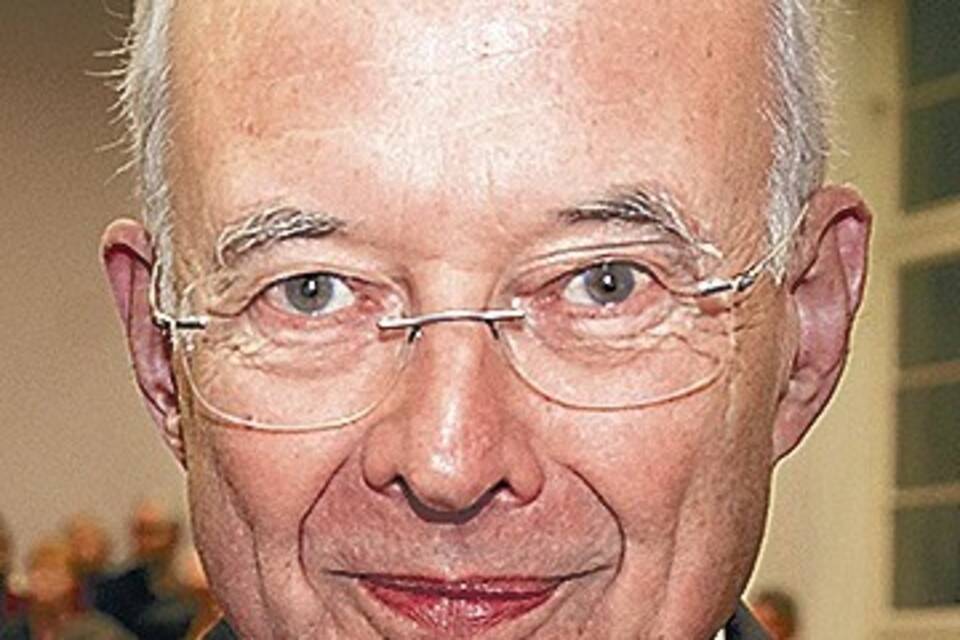
Paul Kirchhof.
Foto: Alexander Müller
Von Heribert Vogt
Heidelberg. "Wenn wir uns von keiner Kultur leiten lassen würden, wäre das bei uns die Ratlosigkeit, das Chaos." Das stellte der Heidelberger Rechtswissenschaftler Paul Kirchhof am Ende seiner Rede "Von welcher Kultur lassen wir uns leiten?" in der Neuen Universität fest. Zuvor war die Veranstaltung in Dieter Borchmeyers Reihe "Vorträge zur Kulturtheorie" wegen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+



