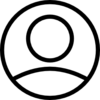"Erinnerungskultur alleine reicht nicht"
Das Erinnern an die Pogromnacht in Eppingen war diesmal kein verstecktes und kein leises Gedenken.

Von Armin Guzy
Eppingen. Der Marktplatz ist voller Menschen an diesem 9. November, mehr als 300 Leute sind da. Erstmals hier, an genau jenem Platz, an dem am frühen Morgen des 10. Novembers vor 85 Jahren viele fanatisierte Eppinger ihre jüdischen Mitbürger zusammengetrieben, gedemütigt und verprügelt haben – abends wiederholte sich das Ganze.
Unter den Schlägern waren damals auch viele Jugendliche, angeführt von örtlichen SA-Männern. Die Synagoge stand schon in Flammen, die Feuerwehr schaute zu, und viele andere schauten weg, als der Hass auf Menschen jüdischen Glaubens in einer Hetzjagd kulminierte, die schon Monate und Jahre zuvor schleichend begonnen hatte.
Erstmals findet der Gedenktag nun an diesem Ort mitten in Eppingen statt, und erstmals sind so viele gekommen. An diesem trüben, nassen Novemberabend wird mit der Wahl des Ortes ein klares, helles Zeichen für Umstehende wie Passanten gesetzt: Schaut hin! Hört zu! Schweigt nicht! "Das Leid, das vor 85 Jahren Juden in Eppingen ereilt hat, darf sich nicht wiederholen", spricht Oberbürgermeister Klaus Holaschke ins Mikrofon und schließt sich der Forderung Angela Merkels nach einem "Kampf gegen Antisemitismus" an. "Juden müssen sich als Teil Deutschlands sicher fühlen", sagt er.
Es ist kein eher verstecktes Gedenken wie in den Jahren zuvor, als am einstigen Standort der Synagoge in der Kaiserstraße Lieder gesungen und die Namen der Eppinger Juden verlesen wurden, bemerkt meist nur von jenen, die bewusst gekommen waren.
Auch interessant
Diesmal ist das Gedenken lauter, präsenter. Es ist geprägt von den zurückliegenden Wochen – in Israel, aber auch in Deutschland und auch in Eppingen, wo zuletzt zumindest mehrere antisemitische Schmierereien entdeckt wurden.
Was von hier aus anonym an digitale Wände geschmiert wird, wie sehr vielleicht auch von hier aus online oder im privaten Rahmen gegen Menschen gehetzt wird, nur weil sie Juden sind, weiß keiner. Dass es diese Fälle aber gibt, weiß jeder. Das Hetzen wird hörbarer.
"Auch die Juden bei uns, die jüdischen Deutschen, bangen um ihr Leben", macht Elisabeth Hilbert eindringlich klar. "Das ,Nie wieder‘ ist zu einem ,Schon wieder‘ geworden, sagt die Vorsitzende des Eppinger Vereins Jüdisches Leben Kraichgau. Sie fordert die Gläubigen unter den Gekommenen zum Beten auf – ausdrücklich "für alle Betroffenen, auf allen Seiten".
Und sie fordert, Farbe zu bekennen, und zwar auch im Alltag. An den Gräueltaten der Nazizeit tragen "wir Heutigen" keine Schuld, stellt sie klar, das betonten auch ihre jüdischen Freunde immer wieder. "Aber für das, was jetzt geschieht, dafür sind wir verantwortlich."
Eindringlich ist auch die Rede von Friedhelm Bokelmann, nachdem die Menge unter Polizeibegleitung durch die Brettener Straße zur Kaiserstraße gezogen ist. Hier steht die Wirkungsstätte des evangelischen Pfarrers; hier stand – vor ihr – die Neue Synagoge. Er zählt auf, woran man sich nicht nur an diesem Tag erinnern sollte: An die "perfide Art und Weise" mit der Juden ermordet wurden, an die nicht löschende Feuerwehr, an das Schweigen der Mehrheit, an das verschämte Wegschauen – "oder wollten sie wegschauen?", fragt er und klammert auch die Mitschuld der Kirchen nicht aus.
Er sei betroffen vom Leid der Vielen, auch "der vielen Palästinenser, die unter dem Terror der Hamas leiden". Und er sei besorgt, sagt Bokelmann, dass "verletzte Menschen Menschen verletzen". Ja, es sei mühsam, zu differenzieren und zu verifizieren, es brauche Mut, sich einzumischen statt zu schweigen. "Aber anders geht es nicht. Niemand ist damit geholfen, wenn wir uns in unser Schneckenhaus zurückziehen."
Bokelmann erinnert daran, dass viele Juden und Palästinenser seit Jahrzehnten friedlich zusammenleben leben. "Ich bete um Wunder und gebe die Hoffnung nicht auf", sagt er.
Wie viele Eppinger jüdischen Glaubens den Nazis zum Opfer gefallen sind oder vielleicht noch fliehen konnten, aber dann hilflos aus der Ferne das Schicksal von Freunden und Verwandten mitverfolgen mussten, machte Schüler der Selma-Rosenfeld-Realschule und des Hartmanni-Gymnasiums deutlich, als sie die Namen verlesen – es sind viele, ganze Familien wurden ausgelöscht, oft ausgebeutet bis zum Tod.
Später, in der evangelischen Kirche, singt der Hartmanni-Chor, unterstützt von Schülern aus Ittlingen, eindringliche Teile aus der Komposition "The Peacemakers" von Karl Jenkins, bevor die Frankfurterin Katja Krämer-Friese zu den Zuhörenden spricht. Sie ist Nachfahrin des einstigen Eppinger Synagogendieners Julius Sternweiler und seiner Frau Liesel.
Das Schicksal ihrer Familie in Eppingen klinge "wie ein Echo" in ihr nach, sagt sie. Ihr Vater konnte 1939 im Alter von 18 Jahren nach Israel emigrieren und kehrte 15 Jahre später nach Deutschland zurück. "Ich dachte, wir sind mit dem Thema durch", bekennt die ehemalige Lehrerin, "aber Antisemitismus wird wieder laut, gefährlich und tödlich – obwohl er zu keiner Zeit zu einer Lösung diente.
Gegen organisierten Volkszorn, gegen Hass und niedere Instinkte nutzen alle Kultur und Religion nichts." Dass sich Schulen gegen Antisemitismus engagieren, sei richtig und sehr wertvoll, aber sie bezweifle, dass Schulen das alleine leisten können. Demokratie müsse vielmehr in den Familien anfangen. Auch die 70-Jährige fordert die Zuhörenden zu Zivilcourage und zum Verteidigen von Menschenrechten und Demokratie auf und regt außerdem an, die Fleischgasse in Eppingen in Sternweilergasse umzubenennen.
Er werde das auf die Tagesordnung des Gemeinderats setzen, verspricht OB Holaschke und erinnert in seinem Schlusswort daran, dass an das Scheitern der Weimarer Republik an der Parteienzersplitterung und in diesem Zusammenhang an die Bedeutung der Wahl zum Europäischen Parlament im kommenden Jahr: "Erinnerungskultur alleine reicht nicht in diesem November 2023."