Seine Übersetzung war "lebendig, frei und klar"
Wie der Heidelberger Wissenschaftler die Bibelübersetzung fand
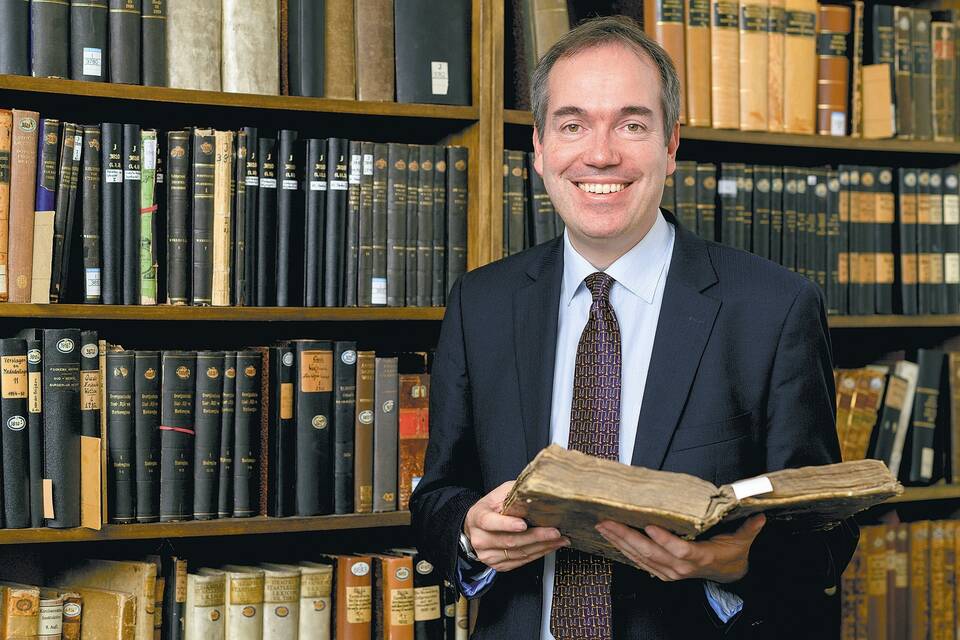
Prof. Andreas Deutsch. Foto: Philipp Rothe
bik. Der Rechtshistoriker Andreas Deutsch ist Leiter der Forschungsstelle "Deutsches Rechtswörterbuch" an der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
Herr Prof. Deutsch, wie sind Sie denn auf Nikolaus Straub gekommen?
Straub hat als Notar Spuren hinterlassen. Er war im Gespräch als Autor eines Rechtsbuches - was ich widerlegt habe. Es gab früher schon Vermutungen, von wem das Bibel-Manuskript in der Leipziger Universitätsbibliothek stammte, aber wegen Besonderheiten des Dialekts ging man in die falsche Richtung. Ich kam auf die Idee, die Unterschrift unter dem Bibel-Text mit Unterschriften auf seinen Notar-Urkunden zu vergleichen.
Straubs Bibelübersetzung sticht hervor unter den Übersetzungen vor Luther wegen ihrer klaren Sprache, sagen Sie. Wer verfasste die anderen Übersetzungen?
Am Anfang stand die "Wulfila-Bibel" als eine Übersetzung ins Germanische, um 370 durch Bischof Wulfila angefertigt. Er musste sich dazu eigens Schriftzeichen ausdenken, denn es gab keine germanische Schrift. Damit ist die Wulfila-Bibel, von der heute nur noch Teile erhalten sind, das älteste größere Schriftzeugnis in einer germanischen Sprache. Im 9. Jahrhundert entstanden die "Mondseer Fragmente" in Kloster Mondsee im Salzburger Land, die unter anderem eine Übersetzung des Matthäusevangeliums ins Althochdeutsche enthalten. Vor allem im 14. und 15. Jahrhundert folgten zahlreiche, meist fragmentarische Übersetzungen.
Auch interessant
Wo sind die alle zu finden?
Es handelt sich ja überwiegend um Handschriften, die man keinem Autor zuordnen kann. Sie liegen meist relativ vergessen in Universitäts- und Landesbibliotheken.
Warum wurde gerade die Lutherbibel populär?
Als Rechtshistoriker bin ich für diese Frage eigentlich nicht zuständig. Aber das hängt sicher mit der Bedeutung Luthers zusammen. Die Bibelübersetzung war nur der letzte Schritt seiner Reformbemühungen. Und nicht zu vergessen: der Buchdruck. Vor Luther gab es zwar auch schon gedruckte deutschsprachige Bibeln - wie die Johannes Mentelins 1466 in Straßburg. Aber er verwendete eine sehr viel ältere, eng am lateinischen Wortlaut klebende Übersetzung, die schon für den damaligen Leser altertümlich und schwer verständlich gewesen sein dürfte. Sehr lebendig, frei und klar ist hingegen die nur in der Handschrift überlieferte Straub-Übersetzung.



