Land will Position in Luft- und Raumfahrt ausbauen
Mission Weltall: Das Ländle will sich nicht von Bayern überflügeln lassen.
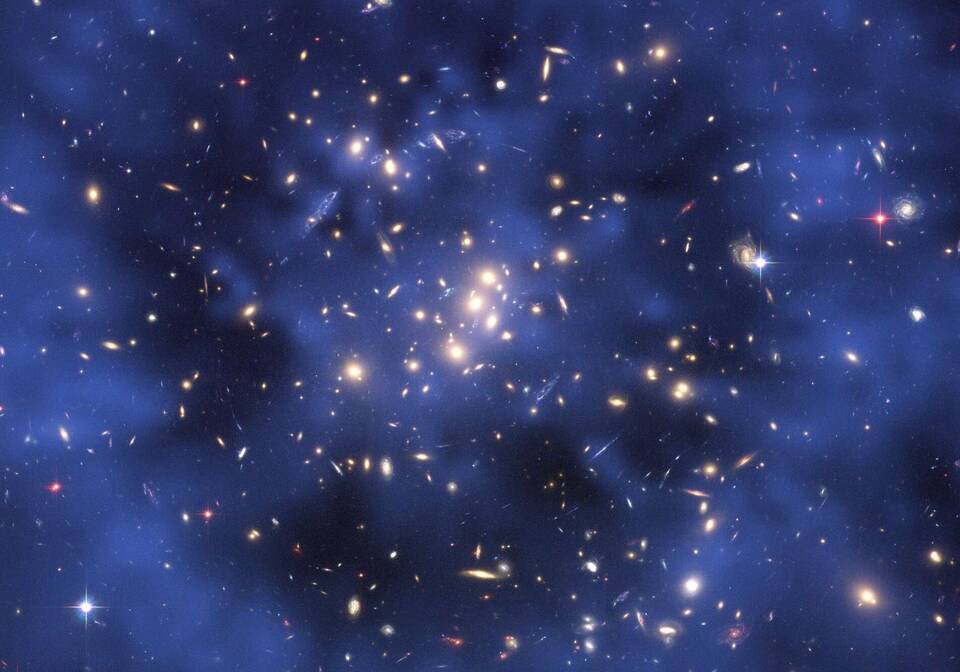
Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart
Stuttgart. Keine Frage, bei den Schlagzeilen gibt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Flughöhe vor. Als der CSU-Politiker 2018 sein mit 700 Millionen Euro Startgeld unterlegtes Raumfahrtprogramm "BavariaOne" ankündigte, gab es zunächst zwar viel Häme. Inzwischen lacht aber niemand mehr. Auf dem bayerischen "Raumfahrtgipfel" vor wenigen Wochen adelte der Chef der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA), Josef Aschbacher, den Freistaat bereits euphorisch als "Weltraummacht". Gastgeber Söder verkündete bei der Gelegenheit eine weitere Finanzspritze für die heimische Luft- und Raumfahrtbranche in Höhe von 50 Millionen Euro. Er sieht es als Investition in die Zukunft.
"New Space" ist inzwischen ein Riesenmarkt, der weltweite Umsatz pro Jahr wird auf einen hohen dreistelligen Milliardenbereich geschätzt. Prognosen zufolge könnte die wirtschaftliche Bedeutung der Branche in 20 Jahren der der globalen Autoindustrie entsprechen.
Auf der anderen Seite der Donau hat man das Potenzial ebenfalls erkannt. Baden-Württembergs Landesregierung vermarktet ihre Bemühungen nur nicht so lautsprecherisch wie Söder. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) wollen sich von Bayern aber auch nicht überflügeln lassen. Denn Baden-Württemberg ist bereits, was der Nachbar mit viel Geld gerade wird: ein relevanter Player.
Die Kompetenzen in der Raumfahrtindustrie im Land sind vorrangig in fünf Regionen gebündelt. Im Bodenseekreis sind neben Airbus Defence and Space viele kleinere Raumfahrtunternehmen aktiv. In Backnang haben sich neben Tesat-Spacecom einige kleiner Firmen angesiedelt. Die Region Stuttgart sticht durch Fakultät für Raumfahrttechnik an der Uni Stuttgart, einen DLR-Standort sowie Ausrüstungs- und Systemzulieferer hervor. Der Standort Ulm punktet mit den neuen DLR-Instituten für KI-Sicherheit und Quantentechnologien. Besonders ragt das DLR in Lampoldshausen mit dem europäischen Testzentrum für Raketentriebwerke heraus.
Auch interessant
Von den direkt Beschäftigten in der deutschen Raumfahrtindustrie arbeiten laut Hoffmeister-Kraut etwa 40 Prozent in Baden-Württemberg. Die Luftfahrt eingerechnet, erwirtschaften 15.000 Beschäftige im Land einen Umsatz von 4,8 Milliarden Euro im Jahr.
Doch auf dem Status quo kann und will sich das Land nicht ausruhen. "Wir sind klug beraten, unsere sehr gute Ausgangsposition auszubauen", sagt Kretschmann. Um die Akteure im Land zu vernetzen, hat er die zuständigen Ressorts mit der Erarbeitung einer baden-württembergischen Luft- und Raumfahrtstrategie beauftragt. Im Doppelhaushalt 2023/24 sind dafür 4,5 Millionen Euro eingestellt.
"Baden-Württemberg ist einer der bundesweit bedeutendsten Standorte der Luft- und Raumfahrtindustrie. Damit wir diese Position halten und weiter ausbauen können, sind weitere Anstrengungen und Investitionen notwendig", findet auch Hoffmeister-Kraut. Daher beteilige sich ihr Haus aktuell mit einer Förderung in Höhe von rund 18,2 Millionen Euro an der Grundfinanzierung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR).
Die Konkurrenz mit Bayern sieht Baden-Württemberg sportlich. Sorgen machen der Landesregierung aber die massiven Investitionen des autoritären China, die auch als Gefahr für die technologische Souveränität wahrgenommen werden. Dass immer mehr Anwendungen satellitengestützt sind, macht "New Space" zu einem Wachstumsmarkt, aber auch sicherheitsrelevant. Verwiesen wird etwa auf den Cyberangriff auf den US-Satellitenbetreiber Viasat am Abend vor dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine. Dass Viasat lahmgelegt war, traf das ukrainische Militär als Kunden genauso wie die deutsche Windkraftbranche: Tausende Anlagen konnten durch den Ausfall nicht mehr ferngewartet werden.



