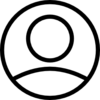Warum die Debatte um das "Facebook"-Gesetz falsch läuft
Was bei der Kritik am "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" zu kurz kommt: Soziale Medien haben schon immer zensiert, aber sind ungern gegen Rechtsverstöße vorgegangen.

Von Reinhard Lask
Wenn es um das "Netzwerkdurchsetzungsgesetz" geht, kommen meist die Kritiker zu Wort. Das Gesetz würde die Entscheidung darüber, was Meinungsfreiheit darf und was nicht,