Immer mehr Eltern lassen IQ-Test bei ihren Kindern machen
Und hoffen auf einen hohen IQ - Tatsächlich ist der Nachwuchs heute klüger als es die Eltern im gleichen Alter waren - Intelligenz als Prestigeobjekt
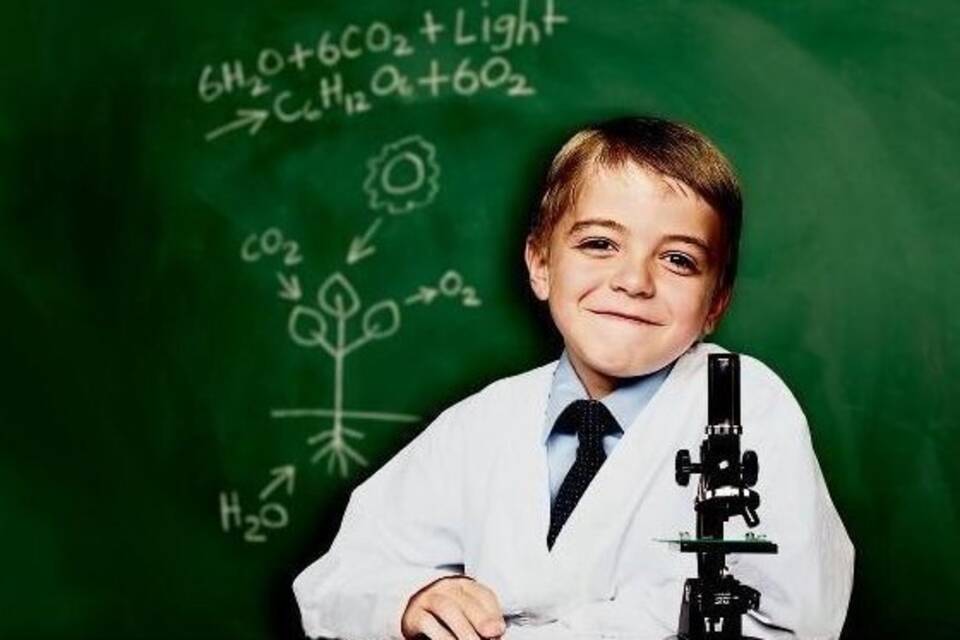
Von Fauke Gans
Marburg. Emil war gerade vier Jahre alt, als er seiner Familie in einem Restaurant die Speisekarte vorlas – in zwei Sprachen und mit unterschiedlichen Alphabeten: auf Deutsch und Griechisch. Zur Verblüffung seiner Eltern konnte er auch in beiden Sprachen schreiben. Wieso der junge Heidelberger das beherrschte, wusste er nicht. Pädagogen drängten die Eltern, den Jungen



