Mithilfe Künstlicher Intelligenz zum medizinischen Befund
Die Software macht im Labor für Mikrobiologie am Uniklinikum Vorschläge bei der Suche nach Erregern.
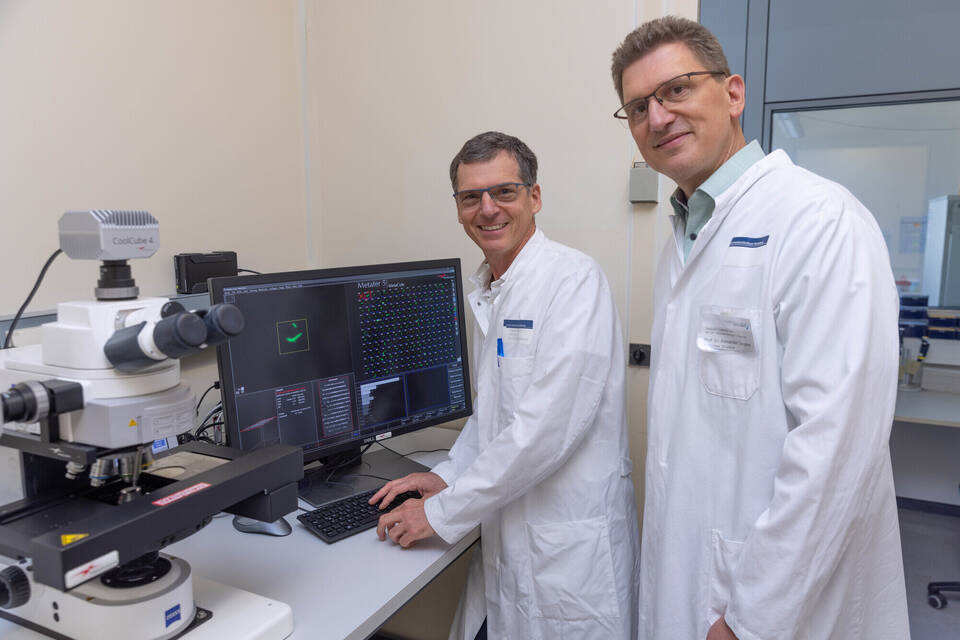
Von Julia Lauer
Heidelberg. Ein Labor im Neuenheimer Feld, die Nachmittagssonne fällt herein, Mitarbeiter sitzen vor Monitoren. Wie an einem Fließband entnimmt in der Mitte des Raums ein Maschinenarm alle paar Sekunden eine Probe aus einem kleinen Fläschchen, das hier durchfährt, und träufelt es mit einer Pipette in eine Petrischale: In diesem Fall handelt es sich um Urin, gesucht wird nach dem Erreger eines Harnweginfekts.
Das, was bis vor einiger Zeit medizinisch-technische Assistenten taten, übernimmt inzwischen eine Maschine: Zunächst streicht sie die Proben auf einem Nährboden aus Algenmaterial aus. Darauf vermehren sich die Bakterien über Nacht bei 37 Grad, sodass sie sich eindeutig identifizieren lassen. Bestimmen lässt sich hier auch, ob sie auf Antibiotika reagieren oder ob es sich um multiresistente Keime handelt.
"Seit 2016 nutzen wir diese Labor-Automatenstraße", erzählt der Mikrobiologe Prof. Alexander Dalpke. Er leitet die Abteilung Medizinische Mikrobiologie und Hygiene am Heidelberger Universitätsklinikum und ist somit auch Chef des Labors mit seinen knapp 40 Beschäftigten. "Wir waren das erste mikrobiologische Labor an einem Universitätsklinikum in Deutschland mit solch einer Straße", erzählt Dalpke, nicht ohne Stolz.
Die Automatisierung in dieser Form war aber erst der Anfang – die Entwicklungen gingen seither weiter. Heute hilft Künstliche Intelligenz auch bei der Auswertung der Proben. "Früher nahm man morgens, wenn man ins Labor kam, die Platten aus den Inkubatoren, in denen sich die Erreger vermehren sollen, und erfahrene medizinisch-technische Assistenten konnten sagen, ob der Keim gewachsen ist und ob er gefährlich ist oder nicht", erzählt Dalpke. Jetzt, in der Maschine, würden die Schalen nun standardisiert nach definierten Zeiten fotografiert. Die Software erkennt dann zunächst einmal, ob sich der Erreger vermehrt hat oder nicht.
Auch interessant
Das ist eine der leichteren Aufgaben, die die Künstliche Intelligenz übernommen hat. Personal habe er damit nicht eingespart, versichert Dalpke. "Wir haben heute nicht weniger Beschäftigte, aber mehr Proben als früher." Bei der Arbeit bedeute die Technik eine Entlastung: "Unsere MTAs können sich so auf die gewachsenen Kulturen und auf die komplexen Fälle konzentrieren. "
Urin, Blut, Auswurf oder Gehirnwasser: An die tausend Proben untersucht das Labor unter der Woche täglich auf Infektionskrankheiten, am Wochenende sind es rund 400 Proben täglich. Die meisten stammen von Patienten am Universitätsklinikum, aber auch Proben aus verwandten Einrichtungen wie der Thorax-Klinik oder von anderen Krankenhäusern der Stadt wie etwa den Schmieder-Kliniken oder dem Ethianum gelangen zur Auswertung dorthin.
Ist der Erreger länglich oder punktförmig? Rottet er sich zu Haufen oder zu kettenartigen Gebilden zusammen? Die Software, die bei Harnwegsinfekten zum Zug kommt, schlägt mittlerweile auch vor, um welche Art von Erreger es sich handelt – hier kommen neben Escherichia coli auch etwa Staphylokokken, Klebsiellen oder Enterokokken in Betracht.
Eine Anhäufung von zehntausend, hunderttausend oder einer Million Keimen pro Milliliter: Die Software muss wissen, wie das aussieht, um dem Erreger auf die Schliche zu kommen. Damit sie die Bilder korrekt ausliest und dabei immer zuverlässiger wird, ist sie auf die Anfütterung mit einer großen Datenmenge angewiesen. Dazu hat Bildmaterial aus diesem Labor beigetragen. Die Software hat der international tätige Medizintechnikhersteller Becton Dickinson entwickelt, der auch in Rohrbach ansässig ist – trainiert wurde sie mit Bildmaterial aus diesem Labor und aus Ljubljana. Inzwischen wird die Software frei verkauft. "Das Labor Limbach nutzt sie auch", berichtet Dr. Stefan Zimmermann, Oberarzt für Bakteriologie.
Künstliche Intelligenz kommt im Labor für Mikrobiologie aber nicht nur bei Harnwegsinfekten zum Tragen, sie hilft auch etwa bei der Untersuchung von Lungenkrankheiten, von Blutvergiftungen und bei der Feststellung von Salmonellen oder Legionellen.
Im Labor für Mikrobiologie steht Infektiologe Dr. Christian Walter vor einem Monitor, auf dem sich grüne Stäbchen tummeln. "Das ist das Mykobakterium Tuberculosis", erklärt er, was er da auf dem Bildschirm vor sich sieht. Die Software hat auf der Grundlage von Form und Färbung festgestellt, dass es sich um den hoch ansteckenden Erreger handelt – nicht etwa nur um Eiter. Über mehrere Jahre hinweg hat Walter die Software des Altlußheimer Unternehmens Metasystems mit mikroskopischem Bildmaterial trainiert. Die Software zeigt ihm Ausschnitte an, die für die Diagnostik vielversprechend sind. Nun arbeitet er mit der Firma daran, die Künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln.
Wie zuverlässig arbeitet sie bisher? Der Bakteriologie Zimmermann hat das am Beispiel von mikroskopischen Präparaten des Tuberkolose-Erregers untersucht. "Die Software findet mehr Bakterien als menschliche Mitarbeiter", berichtet er. Gerade kleine Kolonien des Erregers übersehe man schnell. "Allmählich ist die Maschine dazu in der Lage, Befunde zu übernehmen", fasst er den Stand der Dinge zusammen. Die Software unterbreite dabei aber immer nur Vorschläge, betont er. Denn auch wenn sie immer besser wird: "Am Ende guckt immer noch ein Arzt drauf."




