Gute Platzierung bringt "Verantwortung mit sich"
Beim "Global Health Ranking" schneidet die Uni Heidelberg am besten ab - Kein Grund zum Zurücklehnen, findet Mailin Waldecker
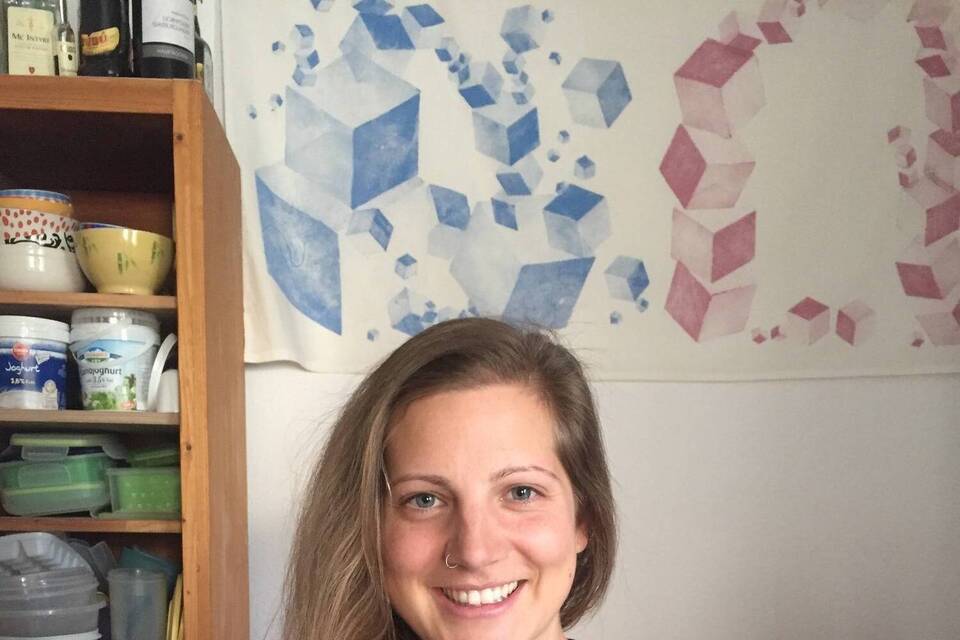
Mailin Waldecker.
Foto: privat
Von Denis Schnur
Heidelberg. Mal wieder ein Uni-Ranking und mal wieder steht Heidelberg ganz oben. Und doch unterscheidet sich die Rangliste bei "Global Health" (Globaler Gesundheit) von ihren Vorgängern: Hier zählen nicht Exzellenz in Forschung oder Lehre, sondern soziale Aspekte und ein globaler Blick (siehe "Hintergrund"). Was in Heidelberg gut läuft und was besser laufen sollte,



