Nach Plagiaten wird besonders bei Prominenten gesucht
Dr. Martin Nissen hilft an der Uni Heidelberg bei der Suche nach und der Vermeidung von Plagiaten. Die Unsicherheit ist deutlich gestiegen.
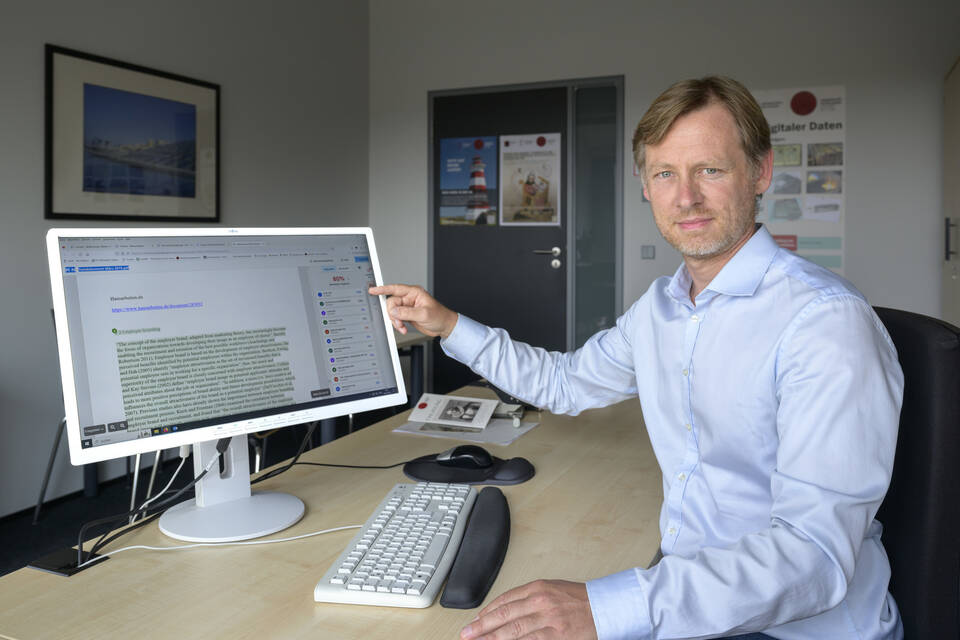


Abteilungsleiter der Heidelberger Unibibliothek
Von Denis Schnur
Heidelberg. Bis 2011 hatte sich kaum jemand außerhalb von Hochschulen mit Plagiaten befasst. Dann kamen Karl-Theodor zu Guttenberg und seine offensichtlich zusammenkopierte Doktorarbeit und plötzlich diskutierte ganz Deutschland über sauberes wissenschaftliches Arbeiten und Schummeleien.
Die Universität Heidelberg reagierte darauf unter anderem mit der Anschaffung der Software "Turnitin", die wissenschaftliche Arbeiten systematisch nach möglichen Plagiaten durchsucht. Dr. Martin Nissen, Abteilungsleiter der Unibibliothek, betreut das Programm – und bietet zudem eine unabhängige Beratung für verunsicherte Prüflinge an.
Mit welchen Fragen die sich rumschlagen, wie viel Prozent seiner eigenen Doktorarbeit kopiert waren und welche Prüfungsformen in Zeiten Künstlicher Intelligenz überhaupt noch sinnvoll sind, erklärt er im RNZ-Interview.
Herr Nissen, Sie sind an der Uni für die Plagiatssoftware zuständig. Haben Sie Ihre eigene Doktorarbeit schonmal überprüft?
Auch interessant
Ja, das habe ich mal ausprobiert.
Was kam dabei raus?
Das Programm schaut, wie groß der Anteil an Formulierungen ist, die mit Quellen, auf die es Zugriff hat, identisch sind. Da kommt eigentlich nie null Prozent raus. Die Software springt an, wenn mindestens fünf Wörter in Folge gleich sind. Das geschieht schnell. Außerdem zeigt sie auch korrekte Zitate an. Die genaue Prozentzahl bei mir weiß ich gar nicht mehr, aber sie war nicht hoch.
Weil Sie wenig zitiert haben?
Das lag an zwei Einschränkungen bei den Quellen, auf die die Software zugreift. Erstens habe ich auf Deutsch geschrieben, da sind viel weniger Texte zugänglich als im Englischen. Außerdem waren meine Quellen fast ausschließlich gedruckt, und zwar in deutschen mittelständischen Verlagen, die bisher nicht in der Software enthalten sind. Hinzu kamen historische Quellen, die zum Großteil noch nicht digitalisiert waren.
Sie hätte also ein Plagiat darin nicht erkannt?
Das ist leider der Widerspruch dabei. In den Fächern, in denen der Text selbst zentral ist – in den Rechts- oder Geisteswissenschaften – steht nur ein Teil der Quellen zum Abgleich zur Verfügung. In den Natur- und Lebenswissenschaften, wo es mehr auf Daten und Ergebnisse ankommt, sieht das ganz anders aus.
Schaut man sich die öffentlich gewordenen Plagiatsfälle an, wirkt es aber, als würde eher in Jura und den Geistes- und Sozialwissenschaften geschummelt.
Der Eindruck täuscht. Das liegt eher daran, dass vorrangig bei Prominenten nach Fehlern gesucht wird – vor allem bei Politikern. Und bei denen sind Rechtswissenschaften, BWL, Geistes- und Sozialwissenschaften beliebt. Solche Fälle beginnen aber in der Regel nicht mit der Software. Meist hat sich jemand Feinde gemacht, die dann gezielt nach Fehlern suchen. Wenn es dann einen Anfangsverdacht gibt, kann die Software helfen, weitere verdächtige Stellen zu finden. Für eine richtige Überprüfung muss man jedoch die zitierten Quellen in das System einspeisen. Das ist ein großer Aufwand, der dann erforderlich wird.
Wenn der vermeintliche Plagiator seine Quelle gar nicht erst angegeben hat, ist man aber machtlos?
So funktionieren Plagiate eigentlich nicht. Typisch ist eher das sogenannte "Bauernopfer": Man zitiert eine Quelle an einer Stelle, schlachtet sie dann an anderer Stelle ohne Beleg aus und übernimmt Ideen als vermeintlich eigene, um – um im Schachbild zu bleiben – die Königin erstrahlen zu lassen.
Prominente Fälle gab es auch an der Uni Heidelberg. Jüngstes Beispiel ist der ehemalige Staatssekretär Patrick Graichen. Landen diese Fälle bei Ihnen?
Als UB sind wir vor allem für die Betreuung der Software zuständig, helfen den Kollegen in den zuständigen Fakultäten bei der Handhabe und den Abläufen. Aber die eigentliche Bewertung liegt in der Hoheit der Fächer – das ist ja auch absolut sinnvoll.
Die Software steht allen Lehrbeauftragten der Uni offen. Wie oft wird sie genutzt?
Alle Prüfungsberechtigten können die Software eigenständig nutzen. Das machen sie rund 6000 Mal im Jahr. Das hat sich gut etabliert.
Und wie viele Plagiatsfälle sind dann darunter?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Die Software spuckt nur einen Prozentwert aus – und der sagt alleine erstmal nichts. Ein Prozent etwa klingt nach gar nichts, kann aber bedeuten, dass von einem 100-Seiten-Paper genau die eine Seite plagiiert ist, auf der – etwa in der Mathematik – der zentrale Beweis steht.
Zehn bis 20 Prozent sind durchaus normal. Da handelt es sich auch um korrekt zitierte Quellen, um bibliografische Angaben oder einfach um etablierte Wissensbestände. Bei Sätzen wie "Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands" muss ich keine Quelle angeben.
War es vor dem Fall Guttenberg einfacher, eine Doktorarbeit zu schreiben und mit Ungenauigkeiten durchzukommen?
Der Fall hat sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt. Dadurch hat sich viel geändert. Es folgten weitere prominente Fälle. Doktoranden heute sind deutlich vorsichtiger.
Kommt mit jedem neuen öffentlich diskutierten Fall eine neue Welle an Beratungsanfragen?
Nein. Nach Guttenberg gab es eine ganz große Welle. Seitdem war die Nachfrage eigentlich relativ konstant mit etwa 30 Beratungsgesprächen im Jahr. Aktuell hat die Diskussion um künstliche Intelligenz wieder zu einer kleineren Welle geführt. Deshalb hatte ich die 30 Gespräche nun schon in der ersten Jahreshälfte.
Mit welchen Fragen kommen denn die Doktoranden?
In der Regel kommen Menschen, die ohnehin sehr darauf achten, korrekt zu arbeiten. Oft geht es um spezielle Themen wie das "Selbstzitat" – also wie man Ergebnisse aus eigenen Arbeiten aufgreifen kann. Vieles dreht sich um das richtige Zitieren. Da gibt es viel Unsicherheit, das ist teilweise ja auch hochkomplex. In der Regel beruhige ich die Menschen erstmal und sage: "Ball flach halten! Wenn ihr eine Fußnote setzt oder einen Verweis, ist es schon mal kein Plagiat im engeren Sinne."
Es kommen also nicht die, die später mal um ihren Doktortitel fürchten müssen?
Nein, überhaupt nicht. Wer zu uns kommt, will ja eben nicht täuschen, sondern alles richtig machen. Wer schummeln möchte oder sehr schlecht organisiert ist, den erreichen wir mit dem Angebot nicht. Ohnehin hat sich ja ein verzerrtes Bild vom "schummelnden Doktoranden" in der Öffentlichkeit festgesetzt. Das deckt sich aber nicht mit der Realität. Das sind absolute Ausnahmen.
Wer schummelt denn dann?
Grundsätzlich kann man sagen: Je qualifizierter, desto weniger wird abgeschrieben. Das ist ja auch logisch: Wenn man im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere mehr selbst erforscht hat, hat man auch mehr zu sagen. Mogeleien und Unsauberkeiten kommen eher bei Schülern und jungen Studenten vor.
Sie haben gesagt, KI bringt Ihnen mehr Menschen mit Fragen in die Sprechstunden. Aber kann die Technik nicht auch beim Schummeln helfen?
Klar, sie kann mir Texte generieren, die wunderbar wissenschaftlich klingen. Aber: Unsere Plagiatssoftware kann das bisher sehr gut erkennen. Die Texte sehen zwar auf den ersten Blick gut aus, sind aber sehr schematisch. Außerdem erfindet die KI Quellen oder ordnet Textstellen willkürlich realen Quellen zu. Solche Fehler sind bislang noch sehr häufig.
Aber das wird sich ändern. Sind Prüfungsformen wie Haus- und Doktorarbeiten langfristig dann noch sinnvoll?
Na ja, da gibt es ja ein Wettrüsten: Die KI wird bei der Formulierung besser, aber die Software auch bei der Erkennung. Im Moment herrscht "Waffengleichheit". Aber es stimmt, die Art der Prüfungen ändert sich schon jetzt. Der Essay ohne Beleg – eigentlich eine schöne, kreative Aufgabe – geht leider nicht mehr. Aber auf längere schriftliche Abhandlungen zu verzichten, wäre ein großer Verlust. Vielleicht läuft es darauf hinaus, dass wir selbst forschen und die KI die entsprechenden Texte formulieren lassen. Aber damit würden wir auch eine sehr wichtige Kulturtechnik stark beeinträchtigen. Auf viele Ideen kommt man ja erst beim Schreiben.




