Planetenjäger "Carmenes" erfolgreich getestet
Heidelberger Astronomen haben neuartiges astronomisches Messinstrument mitentwickelt
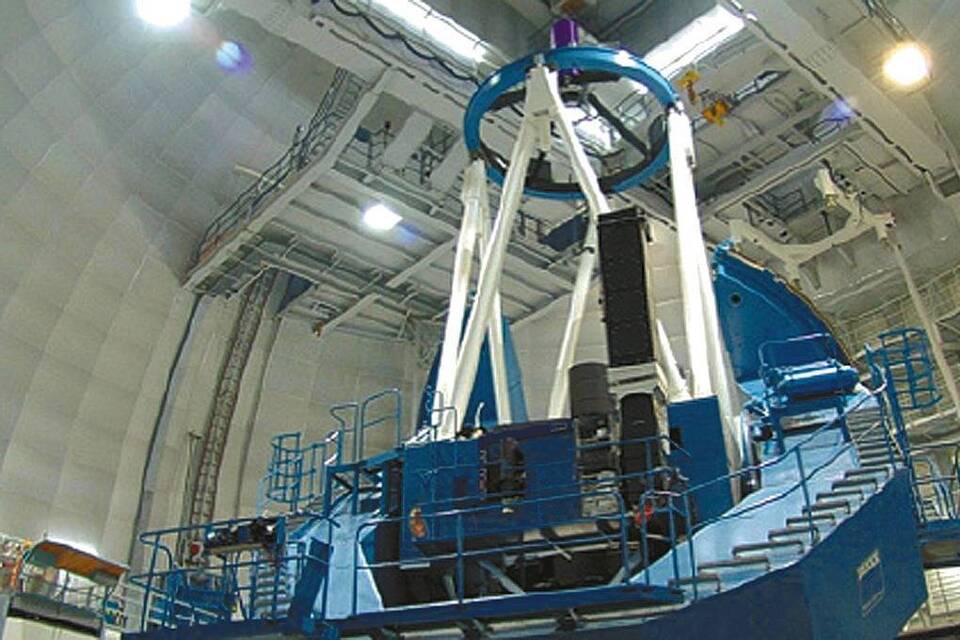
Das 3,5-Meter-Spiegelteleskop auf dem spanischen Berg Calar Alto. "Carmenes" ist an diesem Teleskop installiert und wird dieses Jahr damit beginnen, nach erdähnlichen Planeten bei anderen Sternen zu suchen. Foto: MPIA
upr. Ein neuartiges astronomisches Messgerät, mit dessen Hilfe erdähnliche Planeten aufgespürt werden sollen, ist erfolgreich im Praxiseinsatz getestet worden. Nach fünfjährigen Vorarbeiten kam Carmenes im November 2015 am 3,5-Meter-Spiegelteleskop des Calar Alto Observatoriums nahe Almería in Südspanien zum Einsatz. Das hochkomplexe Instrument wurde von einem internationalen Konsortium aus
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+


