"Auf zehn Patienten kommen in den USA drei Beatmungsplätze"
Heidelbergs Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich über die Coronapandemie in den USA und die massenweise Vorbestellung von Remdesivir
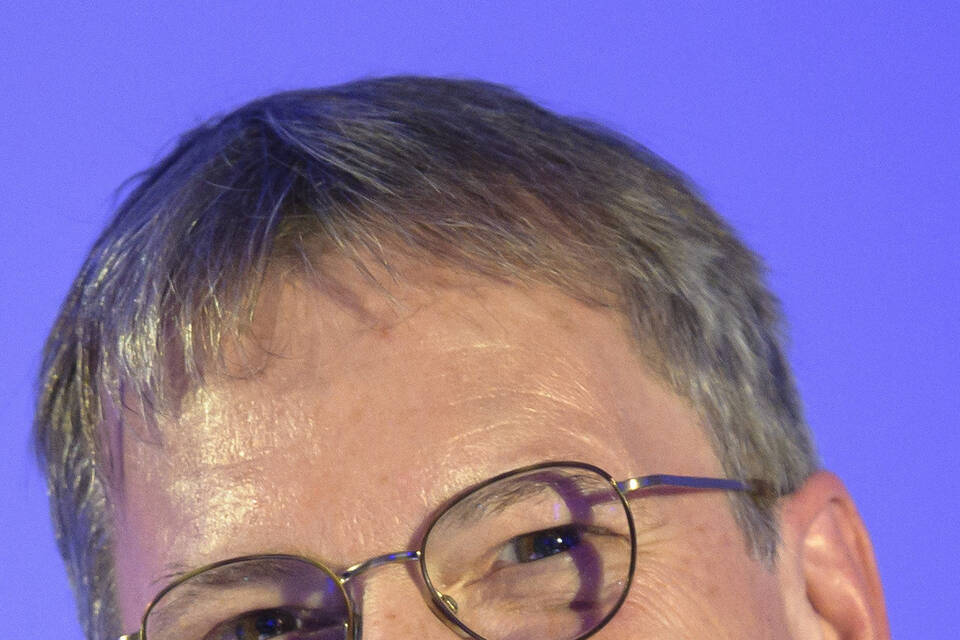
Von Klaus Welzel
Heidelberg. Während die Corona-Pandemie in der Region so gut wie keine Auswirkungen mehr zeigt, spitzt sich die Lage in den USA zu. Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Uniklinikum, hält diese Entwicklung für sehr beunruhigend, wie er in der 18. Folge des RNZ-Corona-Podcasts erläutert.
Prof. Kräusslich, ist es eigentlich denkbar,
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+


